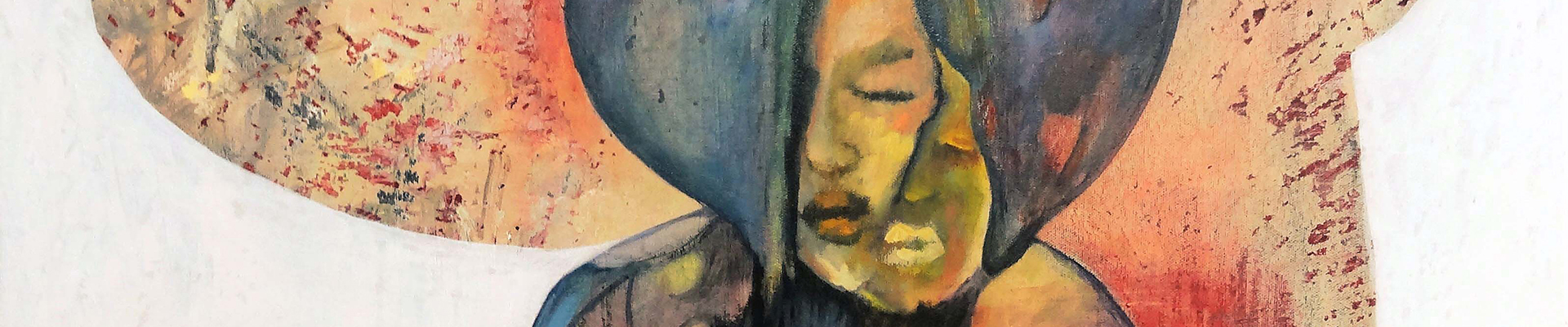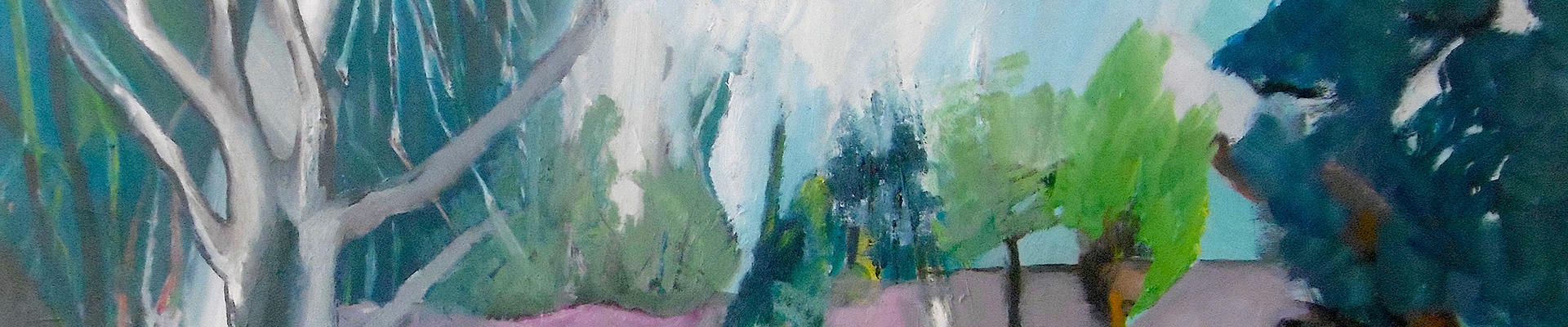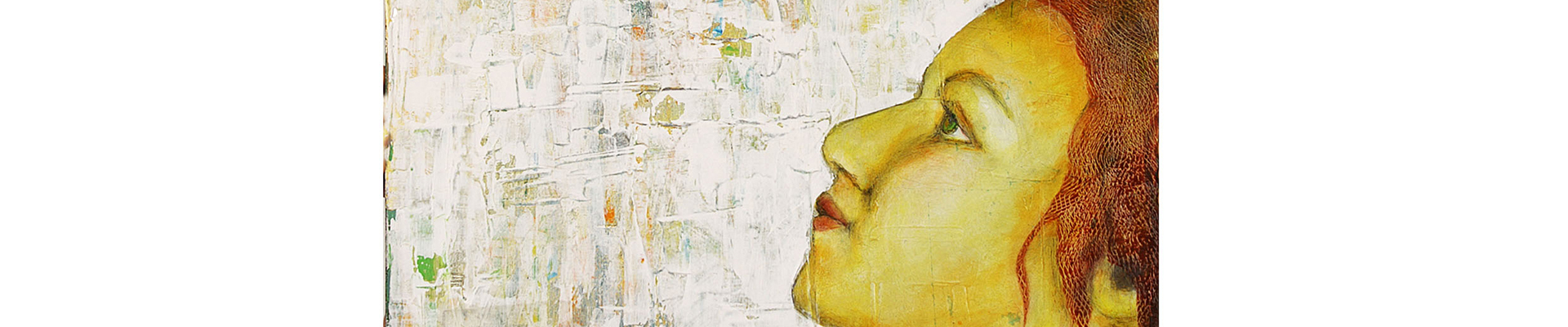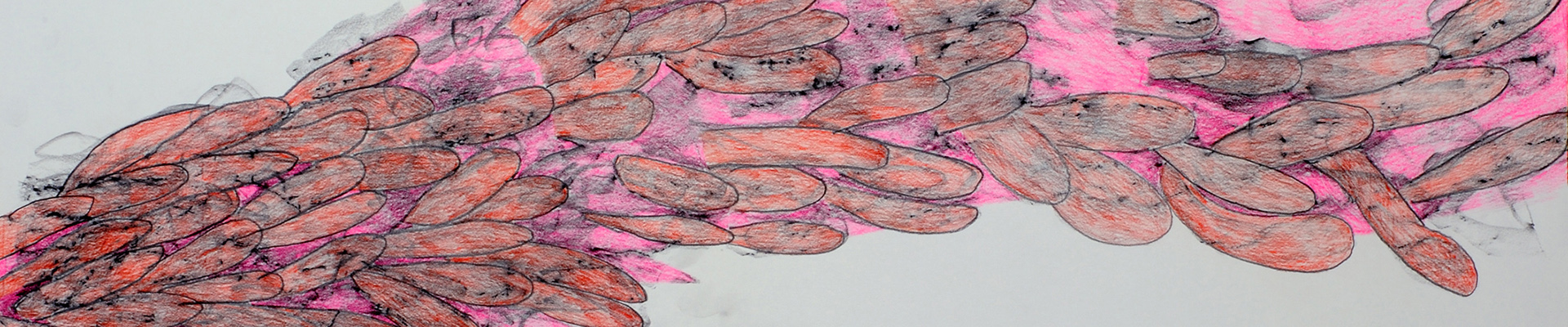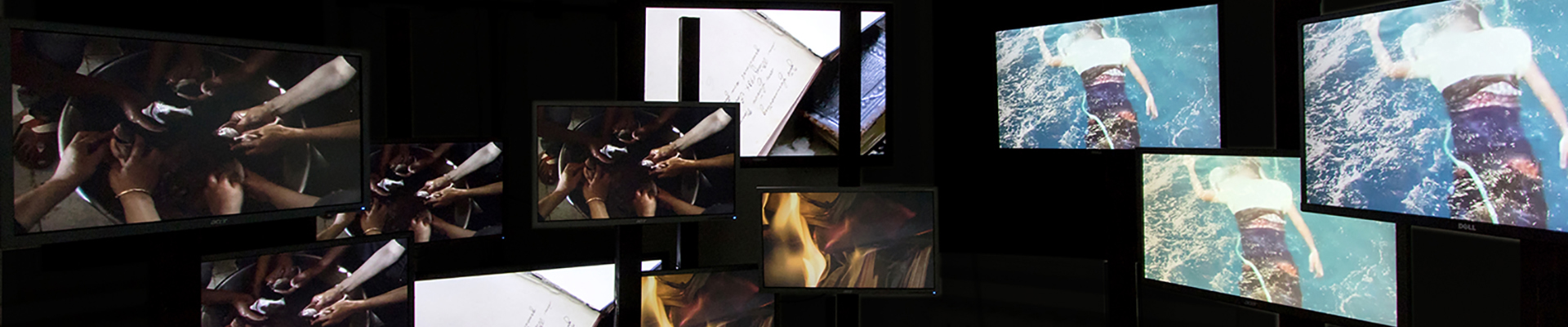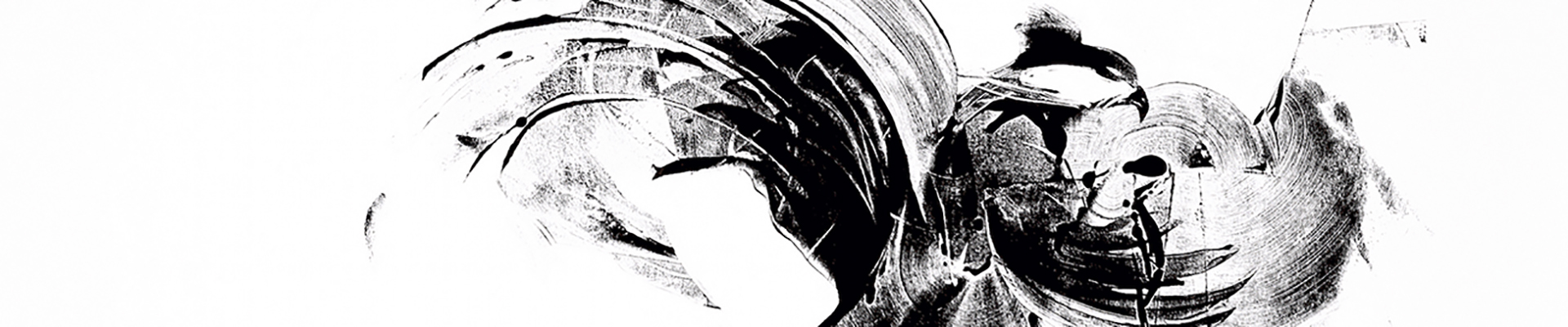Sonntag, 26. Oktober 2025 um 17 Uhr
Programm
Robert Schumann (1810-1956): Op. 43, Nr. 1 „Wenn ich ein Vöglein wär“
Caspar Othmayer (1515-1553): Nr. 14 aus „Bicinia Sacra“
Mauricio Kagel (1931-2008): Nr. 2 (Deutsch), Nr. 3 (Englisch), Nr. 10 (Latein) aus „Der Turmbau zu Babel“
Enno Poppe (1969): Wespe (Auszug)
Henry Purcell (1659-1695): „O solitude“
Georges Aperghis (1945): Récitation 9 & Récitation 8 aus „Récitations“
Morten Feldman: (1926-1987): Only
John Cage (1912-1992): The wonderful widow of eighteen springs
Cathy Berberian (1925-1983): Stripsody
Gustav Mahler (1860-1911): Nr. 3 aus „Rückert-Lieder“
David Lang (1957): When I’m alone
Mit Zwischentexten von u. a. Daniel Schreiber, Mascha Kaléko, Julio Cortazar, Franziska Martienssen-Lohmann und Eva Strittmatter.
Wir bitten Sie herzlich, nach den einzelnen Stücken nicht zu applaudieren und freuen uns, wenn Sie sich den Applaus für den Schluss des Konzertes aufsparen.
ERGÄNZUNG ZUM LIEDERABEND
Die menschliche Stimme gilt nach wie vor als einer der ausdrucksstärksten Träger musikalischer Gestaltung der Klassischen Musik. Von der einstimmigen Gregorianik über die Kunst des Liedgesanges bis ins Heute ist sie ein zentrales Element der Musikgeschichte. Für unsere heutigen Hörgewohnheiten ist Gesang jedoch fast immer mit einem Begleitinstrument verbunden – sei es ein Klavier oder ein Orchester.
Im 20. Jahrhundert, besonders ab der Mitte des Jahrhunderts, begannen Komponist:innen verstärkt mit neuen Formen und Ausdrucksweisen zu experimentieren. Dabei rückte auch die menschliche Stimme als Soloinstrument in den Fokus – losgelöst von konventionellen Begleitstrukturen, in all ihrer klanglichen Eigenständigkeit.
In der Renaissance war es durchaus üblich, rein vokale Werke aufzuführen. Instrumente galten in dieser Zeit häufig als profan und in gewisser Weise als „ungeistlich“, da allein die menschliche Stimme fähig war, das Wort Gottes unmittelbar zu verkünden, während Instrumentalklänge abstrakt und damit weniger geeignet erschienen. Der strenge Einfluss kirchlicher Autoritäten tat sein Übriges – zumal viele Komponisten im Dienst der Kirche standen. Die sogenannten Bicinien greifen den kontrapunktischen Stil Palestrinas auf, der durch das spannungsreiche Wechselspiel von Haupt- und Gegenstimme geprägt ist. Oft basiert ein Bicinium auf einem Cantus firmus in der Oberstimme (Vox vulgaris), dem eine verzierte Begleitstimme (Altera Vox) zur Seite gestellt wird. Ein Beispiel dafür zeigt sich in dem von uns aufgeführten Werk des Komponisten Caspar Othmayr aus dem Jahr 1547.
Im Zentrum von Mauricio Kagels Zyklus „Der Turm zu Babel“ (2003) steht die die biblische Erzählung von menschlicher Hybris: Der Versuch, einen Turm bis in den Himmel zu bauen, wird von Gott durch das berüchtigte babylonische Sprachgewirr vereitelt. Das Werk, bestehend aus eigentlich 18 Vokalstücken in verschiedenen Sprachen, besticht durch die Verbindung zwischen Wort und Klang, die deutlich nachvollziehbar ist. Der Text wird nicht ironisiert oder dekonstruiert, sondern ernst genommen – in einer musikalischen Sprache, die ausdrucksstark und präzise ist.
In Enno Poppes Stück „Wespe“ (2005) bedient sich der Komponist einer sehr konkreten, beinahe naturalistischen Übersetzung von Naturgeräuschen. Das Summen des Insekts wird durch Glissandi – gleitende Tonverbindungen ohne Absetzen – und kleinteilige, sich wiederholende Tonfolgen, die eine kriechende Bewegung erzeugen, erlebbar. Mikrotonale Nuancen – Tonhöhen zwischen den gewohnten Halbtönen – verstärken den Eindruck von Fremdheit und Unruhe. Diese musikalischen Elemente korrespondieren eng mit dem Text von Marcel Beyer. Das vertonte Gedicht weist einige irritierende Besonderheiten auf: So fordert das lyrische Ich die Wespe auf, in seinen Mund zu kriechen, „innen muss die Sprache sein“ – bis hin zur grotesken Aufforderung: „zeig’s dem Deutsch am Zungengrund“. Diese bizarre Verschränkung aus absurden Bildern und die hochvirtuose Behandlung der Singstimme mit großen Sprüngen und rhythmischen Finessen machen „Wespe“ zu einem der ungewöhnlichsten und klanglich eigenwilligsten Solostücke der letzten zwanzig Jahre.
„Récitations“ (1978) des französisch-griechischen Komponisten Georges Aperghis ist ein Zyklus aus 14 Vokalstücken, die auf vielfältige Weise die Schnelligkeit, Wandelbarkeit und Virtuosität der menschlichen Stimme erforschen. Neben Sprechen, Pfeifen und Singen erklingen auch Geräusche wie Husten, Stöhnen und andere vokale Artikulationen jenseits des klassischen Gesangs. Aperghis beschreibt seine kompositorische Haltung so: „Man muss sich ständig Ohren überstülpen, die einem nicht gehören. Diese anderen Ohren hat man nicht; man muss sie jedes Mal erfinden. Sie schaffen, sie bauen wie ein nie gehörtes Instrument, um das nie Gehörte zu hören. Oder besser: um unerhört zu hören.“ In den Récitations wird dieser Gedanke unmittelbar erfahrbar – jede musikalische Geste verlangt nach einer neuen, anderen Art des Hörens.
Im Stück „Only“ (1946) von Morten Feldman wird im Geiste des Kunstliedes eine englische Übersetzung eines Gedichts von niemand geringerem als Rainer Maria Rilke vertont – eine gewagte Entscheidung, bedenkt man, dass Rilkes Sprache oft als unübersetzbar und sakrosankt gilt. Der parfümierten, bildreichen Sprache des Dichters stellt Feldman eine schlichte, sich wiederholende Melodie gegenüber. Die Form ist klar gegliedert: drei Abschnitte, wobei der erste und der letzte fast identisch sind. Diese Struktur bildet einen bewussten Kontrast zum vieldeutigen, rätselhaftenText. Vielleicht liegt in dieser Reduktion aber der Schlüssel: Wer zuhört, beginnt zu verstehen.
Einen vergleichbaren Zugang zur Transformation des Kunstliedes wie Morten Feldman verfolgt auch John Cage – mit feinem Humor und einem gewissen anarchistischen Geist, der sich in The Wonderful Widow of Eighteen Springs (1942) zeigt. Wie Feldman vertont Cage einen vielschichtigen Text – hier eine Passage aus James Joyces Roman Finnegans Wake – und verwendet eine ruhig fließende, sich wiederholende melodische Linie aus nur drei Tönen, wodurch eine meditative Stimmung entsteht. Der zentrale Unterschied liegt in der Rolle des Klaviers: Während Feldman in Only auf eine Begleitung ganz verzichtet, schreibt Cage ausdrücklich eine Klavierpartie vor – allerdings eine, die kaum über ein Flüstern hinausgeht. Sie erinnert fast an sein späteres Werk 4’33”, das nur aus Stille besteht. Das Klavier verstummt hier zwar nicht vollständig, wird jedoch originell umgedeutet.
Cathy Berberian, eine amerikanische Mezzosopranistin und Ehefrau des Komponisten Luciano Berio, zeigt eine ganz andere Seite der Stimmbehandlung: ihr Stück „Stripsody“ (1966) nimmt Comicgeräusche zum Ausgangspunkt. Inspiriert von Pop-Art-Ikonen wie Roy Lichtenstein oder der damals populären Fernsehserie Batman, erschafft Berberian eine Art „umgedrehten Comic“: Wo beim Lesen eines Comics im Kopf Geräusche entstehen, entstehen hier Bilder – allein durch die Stimme. Hinter dem spielerischen Konzept verbirgt sich jedoch eine ernsthafte Haltung: Das Neue-Musik-Publikum galt (und gilt teilweise noch immer) als elitär, intellektuell und distanziert. Dem setzt Berberian eine andere Kraft entgegen – Humor.
Das ursprünglich für Chor komponierte Stück „When I’m alone“ (2015) von David Lang wirkt auf den ersten Blick schlicht, ist jedoch konzeptionell höchst durchdacht. Den Text entwickelte Lang, indem er die Phrase „When I’m alone I“ in die Google-Suchleiste eingab und sich von den automatisch vorgeschlagenen Vervollständigungen inspirieren ließ. So entstand ein Textkorpus aus fragmentarischen Sätzen, die zwischen Traurigkeit, Absurdität, Freude und Gleichgültigkeit oszillieren. Die Ausführenden sind dabei angehalten, in einem „murmelnden“, introvertierten Ton zu singen, als befänden sie sich wirklich allein, bei sich, im eigenen Zimmer. In der von Caroline Shaw und Jodi Elff realisierten Bearbeitung, wie wir sie aufführen, wird dieses postminimalistische Werk zu einer meditativen Improvisation mit Zuspielung – über Einsamkeit, aber auch über die stille Freiheit, die im Alleinsein liegen kann.
Neben den bereits erwähnten Werken haben wir eigene Interpretationen von Kompositionen Schumanns, Mahlers und Purcells in unser Programm aufgenommen. Ihre greifbare, uns möglicherweise vertrautere musikalische Sprache bildet einen wirkungsvollen Kontrast zu den experimentellen Klängen der anderen Komponist:innen. Dadurch eröffnet sich eine weitere Dimension der klanglichen Auseinandersetzung mit der Solostimme – und mit der Nahbarkeit von Gefühlen wie Einsamkeit, aber auch der selbstbestimmten Autonomie im Alleinsein.
Fotorechte:
Hanna Ramminger © Andrea Lang / fotografiehamburg.de
Benjamin Boresch © Michael Schwarze